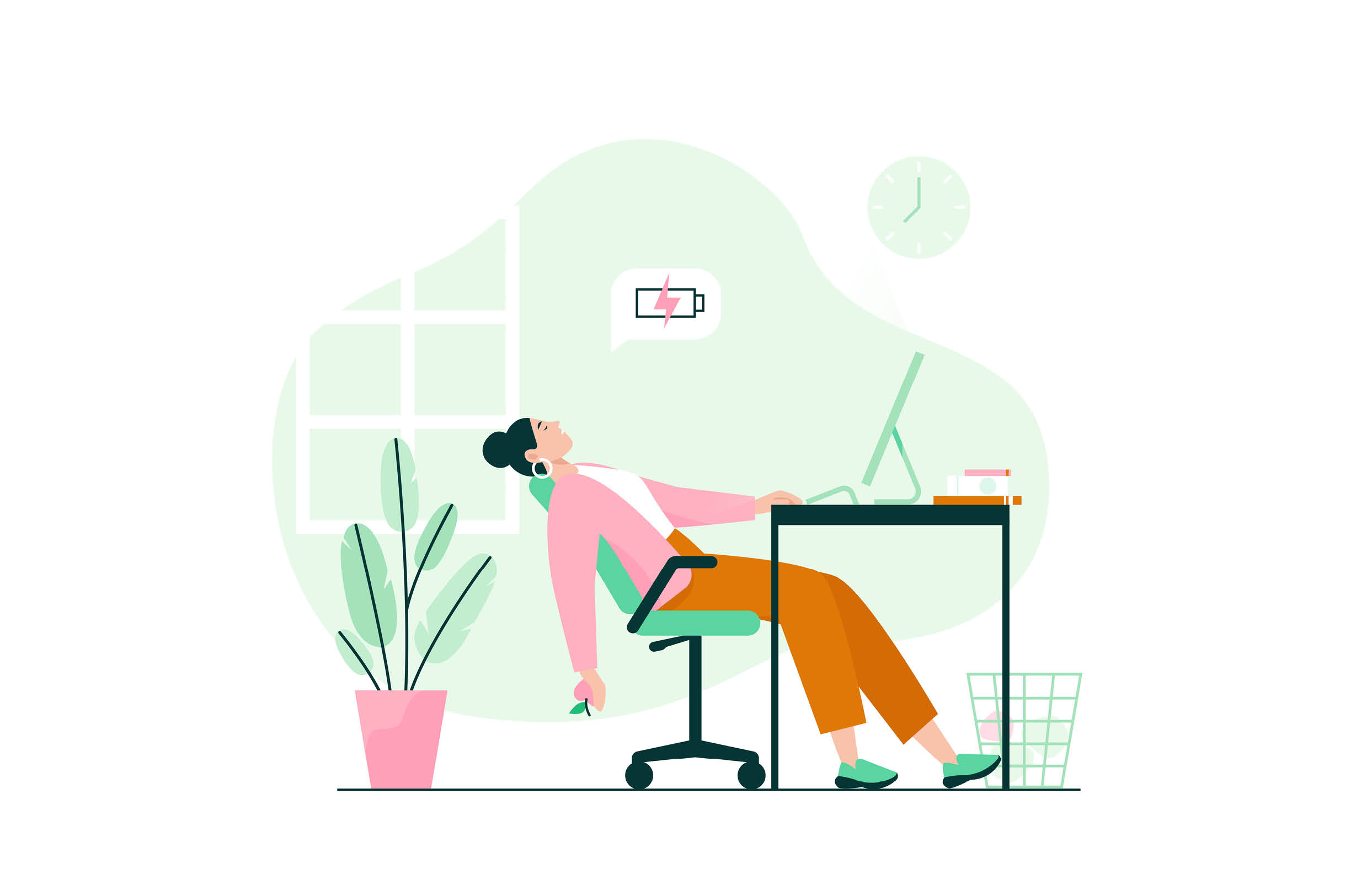Als einzige deutsche Breakerin hofft Jilou auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Die Berlinerin hat sich aus einfachen Verhältnissen an die Weltspitze gekämpft. Unsere Autorin hat sie in der Hauptstadt besucht.
Zur Person

Jilou, Jahrgang 1992, ist in Köln aufgewachsen und lebt aktuell in Berlin. Mit 13 Jahren hat sie mit dem Breaking beim MTV Köln begonnen. Zu ihren größten Erfolgen zählt der zweimalige Gewinn der Bronzemedaille bei den WM 2019 und 2021.


Klicken Sie sich durch die Bildergalerie: Bei Breakerin Jilou stehen Achtsamkeit und Optimismus im Vordergrund
»Sorry, aber das mache ich nicht aus dem Stand. Da muss ich mich erst aufwärmen«, erwidert Jilou auf die Anweisung der Fotografin, zu Beginn ein paar einfache Breaking-Posen für den Artikel zu machen. Was im ersten Moment etwas eigen wirkt, entpuppt sich als ernst gemeinte Antwort einer Spitzensportlerin. Für die Breakerin sind 30 Minuten Aufwärmen und Dehnen vor jedem Tanz Pflicht. Foam Roller, Fitnessband, Knieschoner, Yoga-Elemente – sie überlässt nichts dem Zufall. Auch nicht beim Treffen in Berlin-Mitte. Backstein an den Wänden, die S-Bahn über den Köpfen, die Spree fließt vorm Fenster vorbei – der Showroom nahe der Jannowitzbrücke passt perfekt zu diesem urbanen Sport, in dem das Fotoshooting und der Videodreh für diesen Artikel entstehen sollen. Mit verschiedenen Fotomotiven im Kopf sollte es gleich losgehen. Doch Jilou weiß, was sie kann und was sie braucht. Breaking verlangt enorme Flexibilität. Es ist nicht einfach nur Tanzen. Ihr Körper ist ihr Kapital. Jede Verletzung könnte die alles entscheidende Qualifikation für Paris gefährden.
Breakdance, korrekterweise Breaking genannt, feiert in diesem Jahr seine Premiere als olympische Disziplin. Jilou ist vermutlich die einzige deutsche Vertreterin. Ob sie es tatsächlich nach Paris schafft, entscheidet sich im Juni, knapp zwei Monate vor Beginn der Spiele. Eine Teilnahme wäre die Krönung ihrer Karriere.
Sehen Sie im Video: Jilou zeigt ihr Können im Breaking
Bei den Wettkämpfen – oder besser Battles – zeigen zwei Tänzer:innen abwechselnd ihr Können und versuchen einander zu übertrumpfen. Eine Jury entscheidet über Faktoren wie Originalität, Musikalität, Sauberkeit der Bewegungen und Präsenz. Es gibt viele Dinge im Battle, auf die die Sportler:innen spontan reagieren müssen. Die Teilnehmenden haben zum Beispiel keinen Einfluss auf die Musik, die gespielt wird. Und auch die Bewegungen des Gegners sind nicht vorhersehbar. Jilou entscheidet in jeder Runde neu, wie sie beginnt, welche Elemente sie einbaut und wie sie endet. Nichts wiederholt sich.
Auch ihren eigenen Lebensweg hat Jilou immer selbst gestaltet – trotz vieler Hindernisse. Geboren 1992 in Freiburg, wuchs Jilou Rasul in einer Künstlerfamilie in Köln-Mühlheim auf. Ihr Vater war Maler, der aus dem Irak nach Deutschland geflohen war. Ihre Mutter war eine leidenschaftliche Tänzerin. Geld war in ihrer Familie nicht immer ausreichend vorhanden. In der Schule konnte sie nicht einfach mit auf Klassenfahrt, sondern musste sich jedes Mal vor der Klasse outen und um finanzielle Hilfe bitten. »Ich glaube, die meisten Menschen, die nicht in solchen Verhältnissen aufgewachsen sind, wissen gar nicht, woran man alles denken muss«, erinnert sie sich. Ihre Jugend bestand aus: Anträgen, Anträgen, Anträgen. »Wenn ich den Antrag für die Ermäßigung in der Mensa vergessen hatte, durfte ich dort nicht essen und habe dann manchmal gar nichts gegessen«, erklärt sie. Um sich ihre Karriere als Breakerin zu finanzieren, arbeitete Jilou als Tanzlehrerin, tanzte auf Messen und in vielen großen Shows, wie in Peter Maffays »Tabaluga«. Für eine dreimonatige Tanzausbildung zog sie nach Berlin, wo sie seit 2017 lebt.
»Es ist eine Kultur, meine Kultur«
Breakerin Jilou
Trotz aller Widerstände profitiert Jilou auch von den Herausforderungen als Jugendliche. Sie hat früh gelernt, selbstständig zu sein. Das kommt ihr heute zugute. Denn seit ihrer möglichen Olympiateilnahme ist ihr Zeitplan vollgepackt mit Terminen. Und die managt sie größtenteils allein. Ob Sponsoren oder Fans – sie kann sich vor Anfragen kaum noch retten. Journalist:innen aus der ganzen Republik verfolgen gespannt ihre Geschichte. Ein bis zwei Interviews pro Woche sind für sie normal. Es könnten auch mehr sein. Aber der Fokus soll auf dem Tanzen bleiben.
Denn für Jilou ist Breaking mehr als ein Sport. Einerseits ist es ihr Ventil, um Stress oder Negatives herauszulassen. Auch deshalb sei die Szene in Berlin im Vergleich zu der in anderen Städten besonders aktiv und der Anteil an herausragenden Tänzer:innen groß. »Viele haben hier eine schwierige persönliche Geschichte«, weiß Jilou, »und viele trainieren deswegen besonders intensiv.« Andererseits bedeutet Breaking für sie auch Zugehörigkeit. »Es ist eine Kultur, meine Kultur«, sagt sie. Denn durch ihren Migrationshintergrund sei es oft nicht so einfach zu wissen, wo man hingehöre. »Bei Breaking kann ich sagen: Hier gehöre ich hin. Das ist meine Community, und die macht mich stark«, erzählt Jilou. Der Zusammenhalt in dieser Gemeinschaft ist über Grenzen hinweg enorm. »In anderen Ländern versuche ich deswegen auch heute noch, Tänzer:innen zu kontaktieren. Die Locals nehmen mich sofort in ihre Gruppe auf, geben mir einen Schlafplatz und zeigen mir Orte und Menschen, die Touristen nie sehen würden.«

Als Jilou 2006 mit dem Tanzen anfing, träumte noch kein Breaker, keine Breakerin von einer Olympiateilnahme – schon gar nicht in den Jahren zuvor. Die Tanzform entstand Anfang der 70er-Jahre auf den legendären Hip-Hop-Partys in der New Yorker Bronx. MCS, Breaker, DJs und Graffiti-Künstler fanden dort ihren Platz. Es ging vor allem darum, eine gute Zeit zu haben und sich miteinander zu messen. Es war egal, woher man kam und wer man war, Hauptsache man liebte das, was man tat.
Auch bei Jilou war es Liebe auf den ersten Blick. Ihre Mutter hatte zufällig den »Battle of the Year«, einen internationalen Breakdance-Wettbewerb, im Fernsehen gesehen. Sie wusste sofort, dass dieser Sport ihre Tochter erfüllen könnte. Jilou, die bereits im Bett lag, wurde von ihrer Mutter geweckt, und das, was sie auf dem Bildschirm sah, fesselte sie sofort. »Das wirkte viel kreativer und freier als das Kunstturnen, das ich damals im Verein betrieb«, sagt sie. Beim Turnen gab es immer nur ein klares Richtig oder Falsch. Beim Breaking ist Jilou hingegen eigentlich nie an dem Punkt, an dem sie sagt: »Die Choreografie endet mit diesem Rückwärtssalto.« Sie verließ den Turnverein und machte ihre ersten Schritte in die künstlerische Freiheit im Breakdance-Kurs beim MTV Köln.
Heute zählt Jilou zu den großen Vorbildern in der Szene. Nachwuchstänzer:innen fragen sie nach ihren persönlichen Ratschlägen zu ihrem Werdegang und zu Tanzmoves. Jilou glänzt auch, weil sie als starke Breakerin mehr Frauenpower in den von Männern dominierten Sport gebracht hat. Ihr größtes Idol war dabei die Britin Roxy. »Roxy brach damals Tabus. Sie trug Lippenstift, warf sich beim Tanzen die Haare über die Schultern, legte sich auf den Bauch und wackelte mit den Beinen. Sie war die Vorreiterin für Sex-Appeal und Weiblichkeit im Breaking«, erzählt Jilou. Gesehen hat sie Roxy zum ersten Mal im Fernsehen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London. Die Breakerin habe sie inspiriert, genau diesen Weg zu gehen und dafür zu kämpfen. »Beim Breaking muss es einfach möglich sein, sich so zu zeigen, wie man ist, das zu tragen, worauf man Lust hat«, sagt Jilou.
»Wenn du auf der Tanzfläche nicht so oft performen kannst, nehmen dich die Leute kaum wahr«
Leider haben heute Männer immer noch mehr Möglichkeiten, sich mit guten, gleichaltrigen Breakern zu vergleichen. In Deutschland haben Frauen das nicht. Es ist noch nicht lange her, da gab es nur vier andere gute Breakerinnen. »Natürlich konnte ich auch viel von den Männern lernen«, erzählt Jilou, »aber das körperliche Niveau der Jungs war einfach viel höher. Dementsprechend bin ich damals nicht so weit gekommen.« Dadurch konnte sie auch nicht so viel Erfahrung sammeln. »Wenn du immer nur fünf Runden tanzt, dann sind diese fünf Runden vielleicht gut. Aber wenn man dann im Wettbewerb zehn Runden tanzen muss, schaut man als Frau in die Röhre.« Damit verschwinde auch ihre Präsenz bei den Veranstaltungen. »Wenn du auf der Tanzfläche nicht so oft performen kannst, nehmen dich die Leute kaum wahr.« Das »Gesehen werden« sei so wichtig, weil Breaking ein Ausdruck der eigenen Individualität ist und jeder Tänzer und jede Tänzerin für das gefeiert werden sollte, was er oder sie ist.
Einen weiteren Push in puncto Aufmerksamkeit hat es für sie als Breakerin durch Olympia gegeben. Nur bei der Anerkennung sieht sie immer noch Luft nach oben. Noch werde die Szene von vielen Menschen belächelt, gerade auch in der Sportwelt. »Ich muss mich leider immer noch erklären und beweisen«, sagt sie, »mir wird zum Beispiel oft die nervige Frage gestellt, ob ich davon leben könne.« Jilou hofft, dass ihre Sportart durch die Spiele im Sommer den »Respekt« bekommt, den sie verdient.
Für die heute 31-Jährige werden die Olympischen Spiele in Paris die letzte Chance sein, sich auf der größten Bühne des Sports zu präsentieren. Selbst wenn ihr Körper mitspielt – ihre Sportart wird bei den Spielen 2028 in Los Angeles nicht vertreten sein. Das hat das Olympische Komitee schon beschlossen. Deswegen möchte sie sich neben dem Sport ein weiteres Standbein aufbauen. Aktuell interessiert sie sich für Wirtschaftspsychologie. Wie tickt die Sportbranche? Wie kann man Breaking für jede:n zugänglich machen und zu mehr Bekanntheit verhelfen? Jilous Kopf ist voller Ideen. »Viele verstehen nicht, dass wir den Sport vermarkten müssen. Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass der Sport uns vermarktet«, erklärt sie. Auch wenn es mit der Olympiateilnahme vorerst ein einmaliges Erlebnis bleibt, sieht Jilou für ihre Leidenschaft eine glänzende Zukunft voraus: »Breaking ist für mich keine Eintagsfliege, sondern ein Schmetterling.«
Text Maria Dünninger
Fotos Karolin Klüppel